Erstaunlich modern und doch spürbar alt fühlt sich Ciceros „De Officiis“ beim Lesen an. Damit hatte ich schon gerechnet, weil es mir bei vielen Texten aus der griechischen Antike so ging. Überrascht hat mich indes, wie eindeutig die Sorge ums Gemeinwesen und politische Tätigkeiten für Cicero das höchste Gut sind. Dazu passt der andere Schwerpunkt meiner Leseaufmerksamkeit: der Vorrang des Tätigseins vor dem Denken und Wissenschaften. Dazu gefiel mir der häufige verweis auf Randbedingungen und Umstände unter denen gegebenen Handlungsweisungen gelten oder eingeschränkt werden, doch zurück zum ersten Eindruck.
Modern und alt zugleich.
Cicero bedient sich aus heutiger Sicht klassischer Argumente der Kolonialismuskritik, wenn er die Zerstörung der republikanischen Strukturen an die hingenommenen Untaten römischer Statthalter in den Provinzen koppelt. Ebenso modern ist er, wenn er seine Aussage nur als wahrscheinlich und nicht als gewiss verstanden wissen möchte. Seine Diskussion um Enteignungen und Bodenreformen könnte auch dem 19. oder 20. Jahrhundert entstammen.
Dies wird durch offensichtlich veraltetes kontrastiert: so verwendet er als Ausdruck für etwas unmögliches „auch wenn er meinte, er könne die Sterne zählen oder die Größe der Welt messen“. Beides haben Menschen inzwischen gemacht.
Besonders deutlich jedoch zeigt sich beides, die Modernität als auch das Alter des Textes, aber in der Art seiner Diskussionsführung. Cicero verwendet oft einen einzigen Wert bzw. eine Hauptthese, von der aus und auf die zurück er alle seine Argumente führt. Zum Beispiel, die Pflicht ist es moralisch zu handeln. Diese These wird entfaltet, indem untersucht wird welche von mehreren moralischen Handlungen moralischer sei und eben nicht dadurch, dass verschiedene Pflichten eingeführt werden. Die Idee, dass es neben moralischen andere wünschenswerte Auswirkungen von Handlungen geben könnte, wird immer wieder verworfen. So besteht Cicero darauf, dass die Begriffe nützlich und moralisch Synonyme sind und es eigentlich gar nicht zweier Worte bedarf. Dies geht sogar so weit, dass schon der Gedanke an einen Unterschied zwischen Nutzen und Moral bei Cicero verwerflich ist: „…denn im Zweifel als solchem besteht schon die Schandtat, auch wenn sie sie nicht begehen. Man darf also derartige Überlegungen gar nicht erst aufkommen lassen, wenn das Überlegen als solches schon schändlich ist.“ Diese altmodische Diskussionsführung mit absoluten Werten stößt bei der Funktion des Verteidigers vor Gericht an ihre Grenzen. Die Position des Verteidigers hat Cicero selbst eingenommen und er will sie nicht unmoralisch finden. Ihre Rechtfertigung vollzieht er aber nicht argumentativ, sondern beschreibt lediglich die Funktion der Verteidigung und zitiert eine Autorität, die diese für notwendig hält.[1] Diese altmodische dogmatische Diskussionsführung wirkt trotzdem recht modern, da die aus ihr fließenden Handlungsanweisungen häufig durch Rahmenbedingungen und Verweise auf die konkreten Umstände eingeschränkt werden. So befindet sich beispielsweise in der Diskussion eines pflichtgemäßen Lebens folgender Satz: „So gut es geht, sollte jeder an seinen persönlichen Eigenschaften festhalten, soweit sie nicht fehlerhaft, aber doch individuell sind, um auf diese Weise das Angemessene (decorurri), um das es uns hier geht, leichter zu bewahren.“ Dieser bewegliche Umgang mit dem absolut guten und höchsten Werten, wenn es zur Anwendung im Leben kommt, folgt aus Ciceros Überzeugung, denn „…der ganze Wert der Tugend besteht im Tätigsein.
Tätig sein hat Vorrang
Das Tätigsein steht im Mittelpunkt von Ciceros Denken. Nur die aus der Moral fließenden Taten geben ihr ihren Wert. Nur die aus den Naturwissenschaften[2] folgenden Anwendungen rechtfertigen dieselbe. Trotz Ciceros offensichtlicher Neigung zur Philosophie sieht er die Gefahr des nutzlosen Grübelns, wenn sich die Gedanken mit zu schwierigen Fragen beschäftigen. Er unterscheidet beim Denken anhand der aus ihr folgenden Taten und grenzt die gute Philosophie von der schlechten Schlauheit ab. Die Tat ordnet für Cicero auch noch den Wert der Großzügigkeit: so ist es für ihn besser durch persönlichen Einsatz als durch Geld zu helfen. Ciceros liebe zum tätigen Leben geht sogar so weit, dass es ihm nicht reicht niemandem zu schaden, um gerecht zu sein. Es muss auch noch die Möglichkeit zum Schutz der Schwachen in die Wertung eines gerechten Lebens einbezogen werden. Unterlassen von guten Taten wiegt ihm als Ungerechtigkeit genauso wie schlechtes tun.
Diese Liebe zur Tätigkeit äußert sich vorrangig aber in der Unzahl an einschränkenden Regeln, die dazu dienen, auf den Einzelfall abzustellen, die Auslegung des gebotenen Verhaltens zu erleichtern und gegebenenfalls von der meist richtigen Entscheidung abzuweichen:
Cicero weist direkt darauf hin, dass zur richtigen Anwendung seiner Regeln praktische Erfahrung gehört. Er betont, erst durch ein über das Lesen hinausgehendes Verstehen können die Regel sinnvoll verwendet werden. Der Zweifel in einer Sache ist ein Hinweis darauf sie zu unterlassen. Ein ändern der Umstände ändert auch, was moralisch geboten ist. Geänderte Umstände können sogar von Versprechen entbinden und derjenige, der dies nicht versteht, ist unmoralisch. Der Grad der Verbundenheit zu einer Person bestimmt die angemessene Dankbarkeit. Vom Kampf abzulassen ist vernünftig, darf aber nicht aus Angst geschehen. Vergebung ist eine Tugend, darf aber nicht zur Schwäche werden. Die Eigenarten einer Person bestimmen das für sie Richtige.
Die Einschränkung seiner allgemeinen Ansichten durch den Einzelfall wird besonders
deutlich an folgendem Zitat: „Wer also im Hinblick auf seine eigene, nicht fehlerhafte Natur seine Lebenswahl getroffen hat, der muss auch dauernd daran festhalten […], es sei denn, er ist zu der Erkenntnis gekommen, er habe sich bei seiner Lebenswahl geirrt.“
Die Gemeinschaft, das höchste Gut
Die bemerkenswertesten Stellen des Buches sind für mich ins Ciceros Einstellungen und Empfehlungen in Bezug auf das Gemeinwesen, die Politik und zwischenmenschliches. Er erwartet von guten Menschen, dass sie aufeinander achten und sich gegebenenfalls von Versprechen entbinden. Stets hat Cicero ein Auge auf das gütliche auskommen innerhalb der Gemeinschaft:
- Er erhebt die Dankbarkeit zur wichtigsten Pflicht.
- Er koppelt an das Wesen einer großen Person die Fähigkeit zur Vergebung.
- Er erwartet von guten Menschen, dass sie sich gegebenenfalls von Versprechen entbinden.
- Es ist eine Pflicht, sich auch für unabsichtlichen Schaden zu entschuldigen und Wiedergutmachung zu leisten. Dabei soll man auch noch seine Handlungsgründe erklären.
- Er erwartet, dass Kritik mit Takt geäußert wird und auch dem Getadeltem nützt
- Auch bei Rache erwartet er, dass Maß gehalten wird.
- Und nicht zuletzt gibt es die für einen gerechten Krieg nötige Kriegserklärung
Dabei verliert Cicero nicht aus den Augen, dass die Gemeinschaft letzten Endes aus einzelnen Personen besteht. Dieser Fokus auf den Einzelnen gepaart mit Menschenkenntnis führt zu viele Vorschlägen, wie es gelingt ein guter Bürger und Politiker zu werden. So unteranderem der Rat, bei persönlichem Erfolg auf seine vorherigen Freunde zu hören und zu verhindern, dass man sich mit Schmeichlern umgibt.
Der Einsatz für das Gemeinwesen ist Cicero persönlich der höchste Wert und er betont mehrfach, dass er nur Texte schreibt, weil ihm zum Verfassungszeitpunkt öffentliche Ämter verwehrt sind. Der Einsatz für die Gemeinschaft ist für ihn kein Mittel irgendetwas zu erreichen, sondern ein Selbstzweck der Menschen, da Menschen von Natur aus gesellig sind. Zwar ordnet er die Verantwortung gegenüber anderen Menschen durch die Nähe der Beziehung – die Familie zuerst, dann die Freunde gefolgt von Menschen der eigenen Stadt usw. –, erstreckt das Gemeinwesen prinzipiell aber auf alle Menschen. Er liebt die Republik dafür, dass sie mehreren Menschen die Möglichkeit gibt sich auszuzeichnen und das Gemeinwesen voranzubringen. Besonders deutlich wird der absolute Vorrang den Cicero der Gemeinschaft einräumt, da es die Einzige Abwägung ist, an der er moralisch schwieriges Verhalten empfiehlt: „Wenn du aber ein solcher Mensch bist, dass du dem Staat und der menschlichen Gemeinschaft großen Nutzen zu schaffen in der Lage wärst, falls du am Leben bliebst, ist es nicht zu tadeln, falls du aus diesem Grund einem anderen etwas wegnähmst.“ Folgerichtig sollten daher die Menschen mit der Gabe praktisch zu handeln unbedingt öffentliche Ämter ergreifen.
Es wundert daher, dass es empfohlen wird, sich nicht um „Machtpositionen“ zu bemühen und diese gegebenenfalls sogar abzugeben. Ebenso verwundert seine Ablehnung von Ruhm und öffentlicher Anerkennung, da er an anderer Stelle hierin einen Antrieb für die Bemühungen um das Gemeinwesen erkennt. Dies kann ich mir nur dadurch erklären, dass Cicero die Diktatur Sullas und die Machtergreifung Cäsars erlebt hat und einen Schutz vor solchen Verfassungsbrüchen sucht.
Der Schmerz Ciceros um den Verlust der republikanischen Ordnung ist im Buch greifbar, umso mehr verwundert mich seine Weigerung auch nur über eine Bodenreform oder Umverteilung durch den Staat nachzudenken. Selbst ein Schuldenerlass erscheint ihm frevelhaft und wird mit Diebstahl gleichgesetzt, obwohl die Römer Zinsen kannten und somit das Verleihen von Geld durchaus ein Geschäft war. Die Unverletzlichkeit des Eigentums hat bei Cicero einen ähnlich absoluten Stellenwert wie bei Libertären. Warum ihm dies für so wichtig ist, wird im Buch nicht erklärt, es gibt nicht einmal brauchbare Andeutungen. Im Gegenteil: Das Buch strotz nur vor Verachtung von Geldgier. Cicero sieht Geld vor allem als Möglichkeit großzügig zu sein und gutes zu tun[3], ihm ist Dankbarkeit mehr wert als Geld, er verachtet Bestechlichkeit. Geld kann Tugend nicht ersetzen, ja nicht mal als Motivationsersatz für Tugend herhalten.
Hier zeigt sich das Cicero eine ausformulierte Idee der materiellen Voraussetzungen der Republik fehlt, trotz vielfältiger Aufstände zu seinen Lebzeiten und dem ebenfalls erlebten Einfluss der römischen Eroberungen auf die römische Verfassung. Vielleicht fehlt hier der moderne materialistische Blick. Vielleicht irrt sich Cicero aber auch einfach, so ist er als Mitglied der Oberschicht eines expandierenden Reiches folgender Meinung: „…keine Herrschaft ist so mächtig, dass sie unter dem Druck der Angst lange bestehen kann.“ Wie sehr dies falsch ist, zeigt im zeitlichen Anschluss die Stabilität der römischen Kaiserzeit. In dieser nimmt die Bevölkerungen Unfreiheiten in Kauf, die Cicero sich nicht langfristig hätte vorstellen können.
Eine Leseempfehlung?
Natürlich machen alle diese Punkte das Buch lesenswert, aber besonders hebend ist wie greifbar Cicero in seinem Text als Person ist. Stolz auf seine Leistungen, Trauer um die außer Kraft gesetzte politische Ordnung, Hoffnung für ihr wiederaufleben und Anteilnahme an der Geschichte Roms springen einen aus den Seiten an. Diese erfahrbare Persönlichkeit des Autor – und sei sie auch nur eine Maske und nicht das Wesen des Menschen Ciceros – machen das Buch zu einem packendem Leseerlebnis.
[1] „manchmal das Wahrscheinliche zu vertreten, auch wenn es nicht der vollen Wahrheit entspricht; das würde ich nicht zu schreiben wagen, zumal ich über Philosophie schreibe, wenn Panaitios, der bedeutendste und ernsthafteste Stoiker, dies nicht auch so gesehen hätte.“
[2] Oder wie er es nennt „die Erkenntnis und die Betrachtung der Natur“
[3] Dies ist passend zur Bedeutung der zwischenmenschlichen Beziehungen bei Cicero

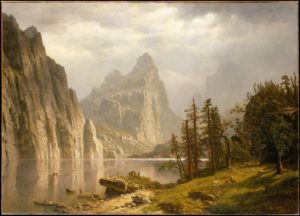

Wurde ja Zeit mal wieder was von dir zu lesen. Prima es ist schon interessant wie bestimmte Probleme die Menschheit über alle Epochen begleiten.