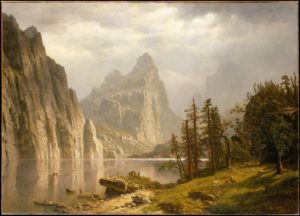Man lernt so viel, wenn man sich der Welt aussetzt und sie betrachtet.
Dieses Jahr habe ich beim Landtagswahlkampf in Rheinland-Pfalz am Straßenstand für die SPD geworben. Bestätigt hat sich meine Erwartung, dass man von Menschen angesprochen wird, die Lust auf Geselligkeit und ein Gespräch haben. Ebenfalls hat sich meine Erwartung bestätigt, dass ich bei Neuem schüchtern bin, weswegen ich zunächst ungern Menschen angesprochen habe. Mit zunehmender Zeit ist mir das leichter gefallen, weil ich in eine Rolle hineingefunden habe, indem ich mir selbst sagte: „Das gehört dazu, darum geht es.“ Dabei drängt sich die Frage auf: Was bringen diese Wahlkampfstände eigentlich? Wieso sollten meine Anwesenheit und die Flyer, die wir verteilen, den Wahlausgang positiv beeinflussen? Dazu kommt, dass ich solche Flyer selbst meistens nicht beachte. Dem starken Anreiz ausgesetzt, dass was ich tue nicht nutzlos zu finden, lautet meine spontane Antwort: Man stellt sich aus. Das Hinstellen zeigt, dass sich die Personen am Stand zur Partei zugehörig fühlen. Diese Positionierung wird verstärkt durch gute Laune und die Bereitschaft, sich Kritik auszusetzen. Bei Menschen, welche sich grundsätzlich vorstellen können, die SPD zu wählen, wirft diese Sichtbarkeit die Frage nach der Wahlentscheidung auf. Kritik wie auch Zuspruch werden durch die Werbung für die Partei direkt provoziert. So erfährt man, wer ebenfalls in der SPD ist, wer bei den Grünen ist und auch, wer von der SPD enttäuscht wurde. Leider bleibt dieser Austausch meist kurz, sodass ich nun nur weiß, dass mindestens eine Frau die Pflegekammer mag, ein Mann Wählen für nutzlos hält und ein anderer der Meinung ist, seine Anliegen würde nicht beachtet. Was seine sind, wollte er nicht mehr mitteilen.
Die Kernerkenntnis des Wahlkampfs kommt nicht vom inhalt der Wortwechsel, sondern von den dabei mitgeteilten Gefühlen. Überrascht wurde ich von der Menge an Personen, die vertraut oder mit Sympathie über Manu Dreyer oder Johannes Klomann mit uns geredet haben. Obwohl ich auf die Frage „Sind die wählbaren Personen wichtig für die Wahlentscheidung?“ mit ja geantwortet hätte, waren Personen für mich selbst nicht wichtig. Stattdessen mache ich mich gerne über einen Wahlkampf lustig, der Personen statt Inhalte in den Mittelpunkt stellt. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie viele Menschen zu den Personen eine Meinung haben, die sie zu Themen seltener haben. Wieso hatte ich hier einen blinden Fleck? Zum einen sicherlich, weil Politik mein Hobby ist, etwas über das ich gerne nachdenke. Meine Gedanken kreisen dabei um konkrete Inhaltliche Fragen (Cum-Ex-Skandal; Wohnungsmarkt; der deutsche Niedriglohnsektor; usw.) wobei mich die abstrakte Lösung meist mehr interessiert als ihre Umsetzung, oder welche konkreten Probleme bei der Umsetzung bestehen. Da aber gerade die Umsetzung und die dabei auftretenden Widrigkeiten die Aufgabe von Politikern sind, habe ich ihnen wenig Beachtung geschenkt.
Trotz dieser geringen Beachtung prägen meine Gefühle zu Herrn Scholz dieses Jahr meine Wahlentscheidung. Weil ich die Indizien um die Cum-Ex-Prozesse und Steuerrückzahlungen der Warburg Bank ausreichend finde, um Herrn Scholz nicht wählen zu wollen. Vor etwas mehr als einem Jahr habe ich mich ausführlich mit dem Cum-Ex-Skandal beschäftigt und im Zuge dessen auch viele Artikel zum Fall der Warburg Bank gelesen. Damals war meine Einschätzung von Herrn Scholz durch eine Abwägung geprägt: Entweder ich finde ihn naiv und nicht klug genug, sodass seine Verwaltung versuchen kann der Warburg Bank 100 Millionen Euro zu erlassen, oder er hat aktiv versucht diese Rückzahlung zu verhindern. In beiden Fällen halte ich ihn als Sozialdemokraten für nicht haltbar. Sechs Monate später, als ich erfahren habe, dass Herr Scholz Kanzlerkandidat ist, blieb von dieser Abwägung und all den Informationen, die ich mir angeeignet hatte, nur ein Gefühl: „Nee, der nicht!“. Wenn mich andere Menschen fragen, warum ich dieses Gefühl habe, kann ich zwar erklären, warum ich Herrn Scholz nicht mag, aber falls sie sich noch nicht mit Cum-Ex beschäftigt haben, überzeugt meine Ausführung nicht, eben weil ich mittlerweile einen Großteil der Informationen vergessen habe. Kann ich die Informationen recherchieren und sie genau benennen, wirkt meine Begründung überzeugender.
Soll ich mich nun grämen, dass ich so viel vergessen habe und am Ende vor allem ein Gefühl zu der Person bleibt? Ich denke, dazu gibt es keinen Grund, da das wichtigste Ergebnis meiner Beschäftigung mit dem Cum-Ex-Thema erhalten geblieben ist: Meine Einschätzungen des Themas. Diese Einschätzung wurde als Gefühle über die wichtigen Personen und Institutionen gespeichert. Diese Gefühle sind zwar anderen nicht ohne erneuten Rechercheaufwand gut zu erklären, aber handlungsleitend für mich. Handlungen werden immer durch Gefühle hervorgerufen. Es gibt vieles, dass ich richtig finde und nur weniges davon, dass ich unter Aufwand auch aktiv fördere. Als Lehrer stören mich einige Äußerungen in meinen Klassen. Zum Beispiel stört mich die Verwendung von „schwul“ und „Jude“ als Schimpfwort. Aber nur bei „Jude“ als Beleidigung habe ich so starke Abneigung, dass ich bereit war, mehr zu tun. Hier habe ich nicht nur darauf hingewiesen, dass das nicht angemessen ist, sondern so viel Zeit und Persönlichkeit aufgebracht, bis diese Äußerungen unterblieben. Die Kraft von Gefühlen zeigt sich auch daran, dass der Glaube an etwas ausreicht, um das Verhalten zu ändern.[1] Zum Beispiel muss die Existenz Gottes nicht bewiesen werden, damit die Gläubigen ihr Verhalten an Religionsvorschriften ausrichten. Das Gefühl des Glaubens allein ist es, dass den Geboten Kraft verleiht.
Für den personenzentrierten Wahlkampf heißt das: Hinter den positiven Gefühlen der Menschen zur Person steht häufig eine Rede, eine Begegnung, die Befolgung eines Wertes oder eine Verbesserung des eigenen Lebens. Wenn diese Gefühle von Themen oder politischer Arbeit herrühren, macht das meinen Spott hinfällig. Auch bei mir ist das Gefühl an eine Person gebunden und auch bei mir beeinflusst es meine Wahlentscheidung, obwohl dieses Gefühl aus einer Beschäftigung mit einem sehr technischen Steuerthema herrührt. Die Verdichtung des Cum-Ex-Themas in meiner Ablehnung von Scholz lässt sich dadurch begründen, dass Personen am Ende Entscheidungen treffen, Stellen besetzen und die Richtung der Entwicklung vorgeben. So durchdacht ist mein Gefühl aber nicht. Meine Gedanken zu Cum-Ex kristallisieren sich einfach an einer Person, weil ich ein Mensch bin und mir andere Menschen wichtig sind. So wie ich auf meiner Arbeit auch Regeln befolge, die ich nicht sinnvoll finde, einfach damit meine Kollegen nicht mehr Arbeit haben, oder weil ich meine Chefin mag und es ihr zuliebe tue, so sind mir Themen präsenter, die ich mit konkreten Personen verbinde. Daraus folgt: Ein die Menschen mitnehmender, themenbezogener Wahlkampf gelingt, wenn die Themen glaubhaft mit einer Persönlichkeit verbunden werden. Dies ist zum Beispiel Greta Thunberg gelungen, sodass sie enorme Aufmerksamkeit für den Klimawandel erzeugt. Das der Klimawandel spürbar wird und sie ein junges Mädchen ist, unterstreicht nur wie viel Aufmerksamkeit die Verbindung von Person und Thema erzeugen kann.
Zu meinem großen Bedauern hatte der Cum-Ex-Skandal bisher wenig Auswirkungen auf Wahlergebnisse. Wahrscheinlich war das Thema emotional nicht besonders zugänglich. Die Korruption bei der Beschaffung von Masken während der Coronakrise scheint hingegen sehr fühlbar. Jeder sieht ständig die Masken, jeder spürt die Einschränkungen in der Krise. Daher bin ich sehr gespannt, ob das Wahlergebnis der CDU darunter leiden wird. Falls mein Gefühl repräsentativ ist, und Gefühle so wichtig sind, wie ich es am Stand erlebt habe, leidet es sehr.
[1] Siehe auch das Thomas-Theorem der Soziologie.