Der letzte Bundestagswahlkampf endet mit der Aussicht, dass Olaf Scholz neuer Bundeskanzler wird.
Trotz meiner Parteimitgliedschaft in der SPD und meiner Einschätzung, dass er der erfahrenste Kandidat ist, freut mich dies nicht. Denn ich nehme ihm seine Rolle in den Cum-Ex-Nachzahlungen der Warburg Bank persönlich übel.[1] Dabei finde ich die der Warburg Bank geschenkten Millionen an sich noch verzeihlich, aber nicht ohne Rechtfertigung, oder Erklärung oder Abbitte oder dem Versprechen, so etwas nicht wieder zu tun. Kurz gesagt: Mir fehlt eine Fehlerkultur in der Politik. Dies scheint nicht auf den Fall Scholz beschränkt zu sein: Die bekannten Fehler von Andreas Scheuer sind vielzählig, öffentlich bekannt und folgenlos; das unrechte Vorgehen von Sebastian Kurz ist öffentlich bekannt und trotzdem reicht es zum Fraktionsvorsitzenden; der begrenzte Aufsichtsauftrag der Bafin bzw. ihr strukturelles Übersehen von Auffälligkeiten war schon seit dem Cum-Ex-Untersuchungsausschuss 2016 bekannt, hat aber zu keiner Änderung geführt, die den Wirecard-Skandal verhindert hat.
Ich halte eine gelungene Fehlerkultur für wichtig, damit die Reflektion zur Verbesserung der Strukturen oder der Verbesserung der Personen oder zu einem Austausch der Personen führt. Unter Fehlerkultur stelle ich mir folgende Elemente vor:
- Dass verständliche menschliche Fehler zugegeben werden.
- Dass eine öffentliche Reflektion der Entscheidungsgründe stattfindet, falls die Entscheidung nicht offensichtlich falsch war.
- Dass eine Diskussion der Strukturen stattfindet, wenn Informationen nicht, oder zu spät gesehen wurden, obwohl sie vorhanden oder leicht zu erheben gewesen wären.
- Dass handelnde Personen durch andere verdrängt werden, wenn die Tat offensichtlich nur eigennützig war.
- Dass eine gute Fehlerkultur durch die Öffentlichkeit belohnt wird.
Beim letzten Punkt werden meine eigenen Gedanken widersprüchlich. Ich finde Olaf Scholz‘ Handlungen bezüglich der Warburg Bank falsch. Seine Kommunikationsstrategie finde ich indes nachvollziehbar, da ich überzeug bin, dass ihm Ehrlichkeit nicht geholfen hätte. Schweigen hingegen hat ihm offensichtlich nicht geschadet. Warum?
Durch Smartphones und Internet sind Nachrichten und mediale Unterhaltung ständig verfügbar und leicht zu produzieren. Dies verstärkt den Wettbewerb zwischen den verschiedenen Medien und gleichzeitig die Menge an Medien in diesem Wettbewerb. Durch die schiere Menge von Medien ist dem Wettbewerb zwischen den Medien und ihrer Qualität ein Aufmerksamkeitswettbewerb vorgeschaltet. Medien oder Nachrichten, die keine Aufmerksamkeit erringen, können gar nicht erst gut oder schlecht gefunden werden. Eine Reaktion auf diesen Aufmerksamkeitswettbewerb ist die hohe Frequenz, mit der neue Artikel auf den Onlinemedien erscheinen. Diese große Menge von Artikeln führt zu einer geringen Zeit, denn einzelne Artikel sichtbar gut sichtbar plaziert sind. Eine weitere Reaktion ist eine Verschiebung zu stärkerer Betonung von Gefühlen, da Gefühle eher Aufmerksamkeit erzeugen als Neuigkeiten. Dies führt dazu, dass einzelne Artikel nur bedingt Aufmerksamkeit erzeugen. Was Aufmerksamkeit bringt, sind ganze Reihen von Artikeln, die in kurzer Zeit hintereinander folgen, sich aufeinander beziehen und immer ein wenig neues oder noch eine Meinung präsentieren. Durch die Menge dieser Serie werden sie irgendwann interessant und es wird irgendein Artikel gelesen. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass auch die folgenden Artikel gelesen werden. Durch diese Mechanismen haben es verschiedene Ereignisse schwer. Darunter
- Langsame Entwicklungen, bei denen nur in größeren Zeitabständen Neues passiert.
- Komplizierte Sachverhalte, die es erschweren, einfache Gefühlsregungen anzusprechen.
- Sachverhalte mit unklarer Faktenlage, die nur durch abgeleitete Informationen oder Annahmen von Wahrscheinlichkeiten zu erfassen und zu bewerten sind.
Unter diesen medialen Bedingungen ist jede Aussage zu einem vermeintlich negativen Sachverhalt und jede konkrete Information schlechter als zu schweigen. Ohne Informationen ist es unwahrscheinlich, dass es zu der nötigen Aufmerksamkeit für einen Skandal kommt. Damit ist wenig sagen, im Idealfall zu sagen, man erinnere sich nicht, die perfekte Strategie, um medialer Aufmerksamkeit zu entgehen. Olaf Scholz hat hier also alles richtig gemacht. Selbst eine gute Fehlerkultur ist unter diesen Bedingungen schlecht. Die Anerkennung der Fehlerkultur setzt die Kenntnis des Fehlers voraus. Es bedarf mehr Menschen, die die Fehlerkultur honorieren, als Menschen, die sich wegen des Wissens um den Fehler abwenden. Ich glaube dies ist nicht der Fall. Betrachtet man noch andere Akteure, im Fall von Scholz andere Parteien, wird das Schweigen noch attraktiver. Durch eine offene Fehlerkultur werden die eigenen Fehler bekannt. Eine andere Partei, die dies nicht tut, steht dann am Ende mit weniger bekannten Verfehlungen da. Daher führt ihr Schweigen dazu, dass Sie redlicher wirkt, obwohl sie in meinen Augen das schlechtere macht.
Dies führt zur Frage des Abends: Ist eine Fehlerkultur wünschenswert? Wenn ja, wie ist es möglich eine politische Fehlerkultur zu etablieren?
Hier einige Ansätze als Fragen formuliert:
Funktionieren Suböffentlichkeiten? Braucht es mehr innerparteiliche Konkurrenz? Ist es möglich in den Behörden oder der Justiz eine höhere Bereitschaft zur Verfolgung von strafbaren Fehlern zu erzeugen? Können hier Whistleblower-Gesetze den Informationsfluss zu den Strafbehörden erhöhen?
Was denkt Ihr? Ich freue mich auf eine Diskussion und einen hoffentlich gelungenen Salonabend,
Johannes (bald 35)
[1]Das Hamburger Finanzamt verzichtete im Jahr 2016 darauf, knapp 50 Millionen Euro aus CumEx-Geschäften von der Warburg Bank zurückzufordern. Ein Jahr später drohte sich das zu wiederholen, bis das Bundesfinanzministerium einsprang.; Seitdem ist ungeklärt, ob der damalige Bürgermeister Olaf Scholz und der damalige Finanzsenator (und heutige Bürgermeister) Peter Tschentscher in den Entscheidungsprozess involviert waren und sich im Interesse der Bank bei dem Verfahren einmischten.Nach dem ersten abgeschlossenen strafrechtlichen CumEx-Prozess musste die Warburg Bank schlussendlich insgesamt 155 Millionen Euro an Steuerforderungen an das Finanzamt Hamburg überweisen.
Aus Tagebucheinträgen von Herrn Olearius wird berichtet, dass dieser versuchte seine Kontakte in die Politik zu nutzen, um das Steuerverfahren noch zu beeinflussen. Er trifft sich demnach offenbar nicht nur mit dem damaligen Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs und dem ehemaligen Innensenator Alfons Pawelczyk, sondern auch dem damaligen Bürgermeister Olaf Scholz. Laut Pressebericht notiert sich Herr Olearius nach dem Gespräch, er interpretiere die Reaktion von Olaf Scholz so, „dass wir uns keine Sorgen zu machen brauchen“. Hier benötigt es Aufklärung von Herrn Scholz. Dieser verweist in einer Befragung des Untersuchungsausschusses allerdings darauf, dass er sich nicht mehr erinnern könne, worum es genau ging. (https://www.finanzwende.de/themen/cumex/olaf-scholz-und-die-warburg-bank/?cookieLevel=not-set)



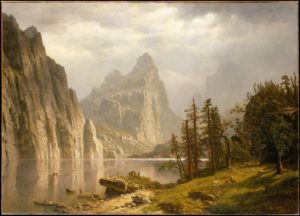
Lieber Johannes,
musste leider den Kommentar unterbrechen und jetzt ist er entweder mitten im Satz abgesendet worden oder verschwunden. Deshalb nochmals von vorne.
Es freut mich, dass du anerkennst, dass es durchaus Gründe für die Entscheidung des Hamburger Senates (nicht nur Olaf Scholz als regierender Bürgermeister) gibt. Ich bin aber natürlich auch deiner Auffassung, dass solche eigentlich unverständlichen Entscheidungen gut begründet werden müssen.
Vielleicht hast du mit deiner Einschätzung recht, dass sich Schweigen bezahlt macht nicht umsonst gibt es das alte Sprichwort „Reden ist Silber Schweigen ist Gold“. Aber ich glaube, dass dies nur kurzfristig gilt, langfristig denke ich zahlt sich Ehrlichkeit aus.
Dein Papa